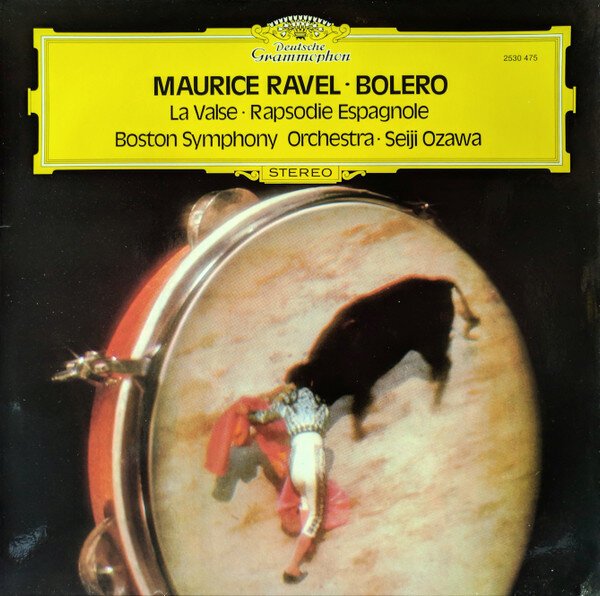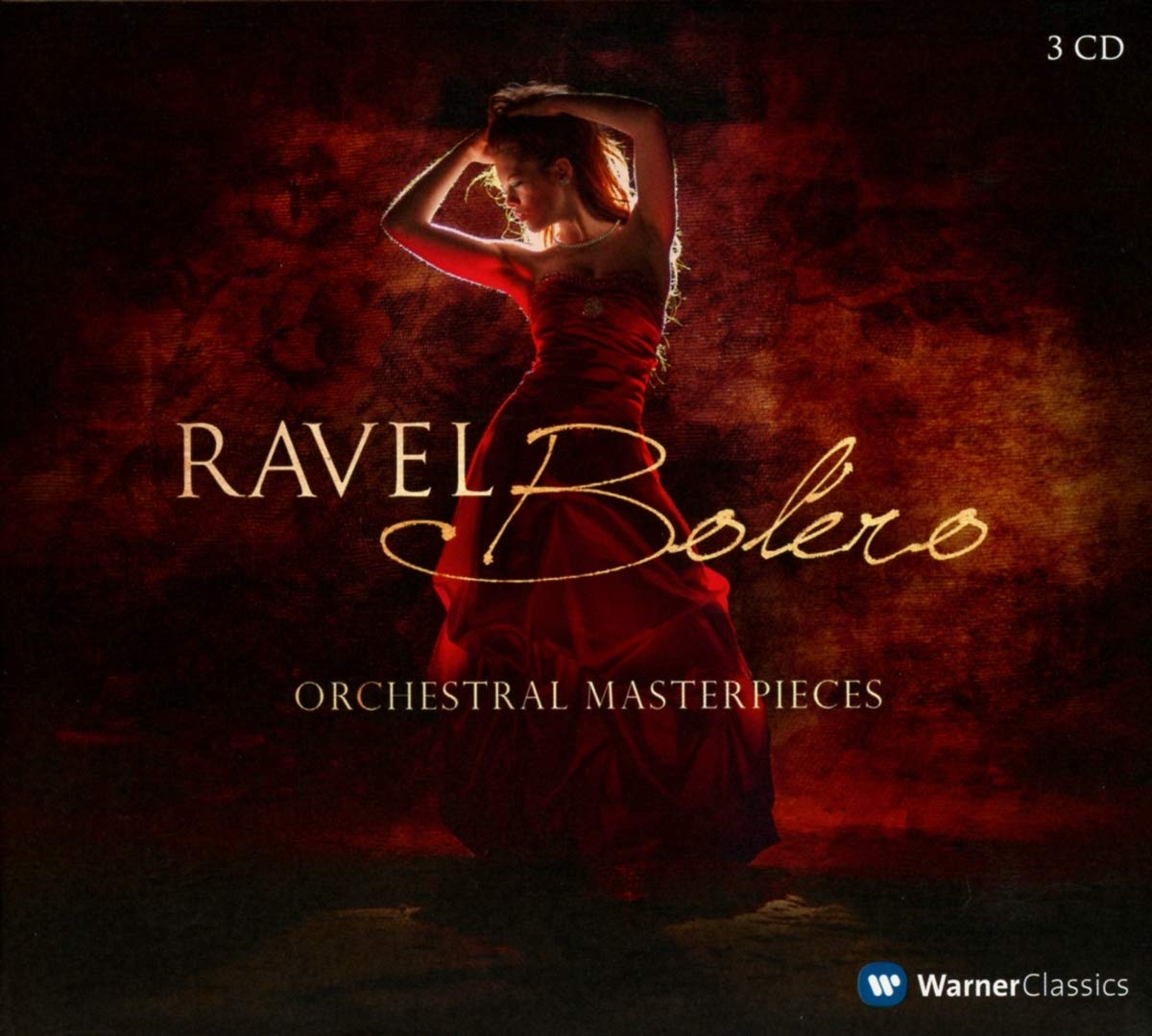Bolero bezeichnet in Lateinamerika eine Musik-, Tanz- und Liedform in gerader Taktart, im 2/4-Metrum, mit einem typischen Rhythmus und unterschiedlichen Tempi (schnell, langsam).
Mit dem homonymen spanischen Volkstanz im 3/4-Takt, bei dem die Paare sich gemäß folkloristischer Tradition rhythmisch mit Kastagnetten begleiten, hat der romantische, lateinamerikanische Bolero nichts als den Namen gemein.
Wortbildung und Etymologie
Das Wort bolero wird gebildet durch Anhängen des Suffixes « -ero » an das Substantiv « bola » („Kugel“). Die etymologische Herkunft des Wortes „Bolero“ in den Bedeutungen von „volkstümlicher spanischer Paartanz im Dreivierteltakt“, beziehungsweise „langsamer Tanz der Karibik“ ist sprachwissenschaftlich noch ungeklärt. In Zeitungsartikeln, Blogs und Foren findet man des Öfteren folgende volksetymologische Interpretation:
Im hispanophonen Iberoamerika werden nämlich anlautendes „b“ und „v“ meist unterschiedslos als „b“ ausgesprochen.
Geschichte des Genres
Der von afroamerikanischen Voodoo-Rhythmen beeinflusste, gefühlsbetonte lateinamerikanische Bolero entstand im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in der Karibik, in Kuba, im Umfeld der Trova, in Puerto Rico und in Mexiko, wo sich zahlreiche Guitarristen-Trios formten.
Als erster karibischer Bolero gilt Tristezas, komponiert 1883 von José "Pepe" Sánchez (1856–1918), der als stilbildender Musiker der traditionellen kubanischen Trova angesehen wird. Viele Bolero-Texte bestehen aus vierzeiligen Strophen, die jeweils ihre eigene, zwei Zeilen umfassende und dann wiederholte Melodie haben. Der zugrundeliegende Rhythmus war ursprünglich der cinquillo des Danzón:
Der Bolero verbreitete sich überall da, wo kubanische Son-Gruppen auftraten, und wurde mit dem Aufkommen des Tonfilms in ganz Lateinamerika populär. So gilt inzwischen Mexiko als mindestens ebenso wichtig für den Bolero wie Kuba. Bedeutende mexikanische Komponisten sind Consuelo Velázquez, María Grever oder der ehemalige Barpianist Agustín Lara aus Veracruz, dessen Lied Granada (oft im Paso-Doble-Rhythmus interpretiert) weltbekannt wurde. Seine Blüte hatte der karibische Bolero in der Zeit zwischen 1930 und 1960.
Wichtige Interpreten waren Toña la Negra, Pedro Vargas, Chavela Vargas, Olga Guillot, La Lupe, das Trío Los Panchos und Pedro Infante. Einen „Schlüssel-Bolero“ stellt wohl María Bonita dar, den Agustín Lara seiner geschiedenen Frau, María Félix (1914–2002), widmete, der berühmtesten Filmschauspielerin Mexikos der 40er und 50er Jahre.
In den USA wurde er in Form von Latin ballads mit Orchesterbegleitung bekannt (in Lateinamerika bolero-filin genannt), wie zum Beispiel durch Nat King Coles, Paul Ankas und Frank Sinatras love-songs.
Nach dem Zerfall der Sowjetunion erlebte der Bolero in Kuba während der sogenannten „Sonderepoche“ nach 1990 einen Wiederaufschwung, vor allem in homosexuellen Kreisen. Durch die Doppeldeutigkeit seiner Poesie eröffnete der Bolero der dortigen LGBT-Gemeinschaft, vor allem in privaten Kreisen, einen „emotionalen Freiraum“ des Eskapismus.
Die Peruanerin Tania Libertad bemüht sich in Mexiko um eine zeitgemäße Adaption des Boleros. Auf den Kanarischen Inseln gehören Boleros zum festen Repertoire des international bekannten Männerchors Los Sabandeños. In der Stadt Santiago de Cuba, die sich als „Wiege“ (« la cuna ») dieses Genres versteht, findet jährlich das „Festival Boleros de Oro“ statt, das auch eine Attraktion für Touristen darstellt.
Instrumente, Bolero-Varianten, Tanzstile
Typische Instrumente
Typische Perkussionsinstrumente des Genres sind Bongos, maracas, claves, sowie der hohle, geriffelten Güiro.
Typische Saiteninstrumente sind Guitarre, Requinto und Klavier.
In manchen Boleros hört man Blasinstrumente wie Trompete (oft mit Sordine, um eine weichere, sanftere, nostalgische Klangfarbe zu erreichen) und Flöte.
Varianten des Boleros
Neben dem klassisch-kubanischen Bolero unterscheidet man – je nach dem gespielten Rhythmus – diverse Bolero-Varianten:
bolero-filin (feeling), bolero-guaracha, bolero-habanera, bolero-jazz, bolero-mambo, bolero-moruno (mit Flamenco-Elementen), bolero-ranchera, bolero-son, bolero-tango, bolero-zamba.
Tanzstile
Langsame Boleros werden eng umschlungen (« bailar en un solo ladrillo »; wörtlich: „auf einer einzigen Bodenkachel tanzen“, quasi auf ein und derselben Stelle tanzen),sinnlich, ähnlich wie Blues getanzt.
Schnellere Boleros werden offener getanzt, mit karibischem Hüftschwung und Rumba-, Cha-Cha-Cha-, Mambo oder Salsa-Schritten und Figuren.
Liedtexte
„Dos gardenias“
Der „unsterbliche“ Bolero Dos gardenias der kubanischen Komponistin Isolina Carrillo gehört zum Repertoire des puerto-ricanischen Sängers Daniel Santos und des Kubaners Antonio Machín
Antonio Machín interpretiert Dos gardenias mit seiner ambivalenten androgynen Stimme, einer Gender-Eigenart, die sich bei vielen Bolero-Sängern und -Sängerinnen wiederfindet:
„Voy“
Der Text des Boleros „Voy“ ist insofern exemplarisch, als sich hier schon in den ersten beiden Strophen sowohl lateinamerikanische Hyperbolik, masochistische Elemente als auch christlich-religiöse Anspielungen vereinen. Die exil-kubanische Künstlerin Olga Guillot, genannt « La reina del bolero » („Königin des Boleros“), interpretiert ihn in ausdrucksstarker Körpersprache.
„La Copa rota“
Ein hoch emotionaler Bolero-chachacha des puerto-ricanischen Komponisten Benito de Jesús, der zum Repertoire des puerto-ricanischen Gitarristen und Bolero-Sängers José Feliciano gehört:
Sprachliches und Literarisches
Semantik, Wortbildung, Etymologie
Semantische Konnotationen
Das amtliche Wörterbuch der spanischen Sprache führt unter dem Lemma bolero neben den musikalischen Bedeutungen „langsamer Tanz der Karibik“, „volkstümlicher spanischer Paartanz im Dreivierteltakt“ und „(professioneller) Bolero-Tänzer“ auch folgende mitschwingende pejorative Konnotationen der Vokabel bolero auf:
- Lügner (¡Qué bolero eres, no te las crees ni tú! – „was für ein Lügner bist Du, das glaubst Du wohl selber nicht!“)
- Schulschwänzer; jemand, der blaumacht (persona que hace novillos).
Anspielungen auf diese abwertenden Nebenbedeutungen des Wortes bolero findet man zum Beispiel in Titeln wie Miénteme („Lüge mich an!“) und Miénteme más („Erzähle mir noch mehr Lügen!“). Romantisches Liebesgeflüster wird in Bolero-Texten zwar als unehrlich dargestellt, doch solche Lügen sind zum Selbstbetrug erwünscht; zum Beispiel:
und:
Sprache der Verführung und des Verlangens
Die Liedtexte sind sentimental-romantische Liebeslyrik, « canciones de amor y de desamor » („Lieder von Liebe und Liebesverlust“). Der Bolero besingt ebenso die Sehnsucht nach „ewiger Liebe“ (« amor eterno ») wie Desillusion, Leidenschaft, erotisches Verlangen, Verführung, Betrügereien, Vorwürfe und Eifersuchtsdramen.
Eine Vielzahl der Bolero-Texte verwendet das imperativische Stilmittel der Apostrophe, die beschwörende, anflehende Hinwendung zu einer (geliebten) Person:
„Hör' mir zu!“ («¡atiéndeme! », « ¡escúchame! », « ¡oye! »); schau' mich an (« ¡mírame! »); „schwöre mir!“ (« ¡júrame! »); „¡versteh’ doch!“ (« ¡comprende! »); „küss’ mich!“ (« ¡bésame! »); „liebkose mich“ (« ¡acaríciame! »). Im amurösen Diskurs des verführerischen Boleros, in der Sprache der Verlangens, begegnet man imperativischen Aposthrophen des uneigentlich Gemeinten, wie „vergiss mich!“ (« ¡olvídame! »), wobei stillschweigend unterstellt wird: ich weiß aber, dass Du das nicht kannst! „Geh’ weg!“ («¡vete!»), (« ¡aléjate! »), wobei eigentlich gemeint ist: „bleibe doch!“
Der Bolero-Interpret ist – wie jeder Verführer – Schauspieler. Bei der Sprache der Liebe geht es ihm nicht um Wahrheit, ihn interessiert nur die Wirkung der poetischen Worte, der Effekt der verführerischen «palabras de bolero» (Bolero-Worte). – „Was als wahr wirken soll, darf nicht wahr sein“:
In diesem Zusammenhang stellt die Bolero-Expertin Iris M. Zavala mit Nietzsche die rhetorische Frage, wie viel Wahrheit ein Mensch verträgt:
Anschluss an trobadoreske Liebeslyrik
Kubanische Gründer des Genres fühlten sich in ihrem Selbstverständnis als Nachfolger mittelalterlicher Trobadore, ein Phänomen, das auch in der wörtlichen Selbstbezeichnung der musikalischen Bewegung Nueva Trova seinen Ausdruck fand. Ähnlich wie in der trobadoresken Ideologie der höfischen Liebe wird die Frau extrem idealisiert und der Mann ist ihr hörig. Diese Unterwerfung des Mannes besingt zum Beispiel der Bolero Entrega total (völlige Hingabe):
Wie in mittelalterlicher Liebeslyrik finden florale Metaphern Verwendung. Der Vergleich umschlungener Liebender mit untrennbarer botanischer Symbiose, wie im Bolero La hiedra (Efeu), erinnert an eine ähnliche Metapher im altfranzösischen Lied vom Geißblatt:
Im Bolero Dos gardenias (Zwei Gardenien) personifizieren diese Blumen die Liebenden. Gardenien bedürfen treuer Pflege wie die Liebe, die sonst genau wie die Gardenien verwelkt. (Siehe Abschnitt Liedtexte).
Zwischen christlicher Moral und Norm-Überschreitung
Moralvorstellungen, die in Bolero-Texten zum Ausdruck kommen, sind ambivalent. Zum einen folgen sie den Normen traditioneller christlichen Lehre und verurteilen außereheliche Beziehungen als « pecado » (Sünde), als « lo prohibido » (das Verbotene), wie zum Beispiel in den ersten beiden Strophen des Boleros Pecado des argentinischen Komponisten Armando Pontier:
Zum anderen begegnet man Appellen zur Norm-Überschreitung, wie zum Beispiel im Bolero Sígamos pecando des puerto-ricanischen Komponisten Benito de Jesús.
Bolero-Poeten spielen außerdem doppeldeutig mit den beiden Moralvorstellungen, wie zum Beispiel im Bolero Soy lo prohibido des mexikanischen Komponisten Roberto Cantoral, in dem das Verbotene (« lo prohibido ») gepriesen wird:
Mariano Muñoz-Hidalgo fasst diesen Widerstreit der Moralen in einem Essai wie folgt zusammen:
Übersteigerter Ausdruck in der Darbietung – „Camp“-performance
Die jüdische Publizistin Susan Sontag bezeichnet in ihrem Essay Notes on Camp die Darstellungskunst der kubanischen Bolero-Sängerin La Lupe als ein Beispiel für „Camp performance“.
Im Englischen hat „Camp“ die Bedeutung von „exaggerated effeminate mannerisms, usually affected for amusement“. Susan Sontag kommentiert in 58 Anmerkungen („notes“) die Verwendung des Wortes „Camp“.
„Camp“ steht für ein ästhetisches Phänomen, für die Metapher vom „Leben als einem Theaterspiel“ und für „affektierte Selbstdarstellung“ bei schauspielerischen Darbietungen:
Bolero-Interpretinnen wie La Lupe, Olga Guillot und Chavela Vargas gelten in der hispanophonen Welt wegen ihrer übersteigerten vokalen Technik, Mimik und Gestik als „Camp“-Ikonen. Susan Sontag charakterisiert diese Übersteigerung künstlerischen Ausdrucks in ihrer achten Anmerkung zu „Camp“ wie folgt:
Nicht nur professionelle Interpreten schalten in einen solchen tranceartigen „Camp“-Bolero-Modus um, sondern auch junge Frauen und Männer, die sich zum informellen Singen von Boleros in privatem Kreise treffen. Moshe Morad berichtet von einem solchen Treffen Homosexueller in Kuba:
Komponisten, Textdichter, Interpreten, Musikstücke
Komponisten und -Textdichter
María Grever (1885–1951), Rafael Hernández Marín (1891–1965), María Teresa Vera (1895–1965), Agustín Lara (1897–1970), Benito de Jesús (1912–2010), Chucho Navarro (1913–1993, einer der drei Gründer des Tríos Los Panchos), Alfredo Gil (1915–1999, ebenfalls einer der drei Gründer des Tríos Los Panchos), Consuelo Velázquez (1916–2005), Chucho Martínez Gil (1917–1988), Federico Baena Solís (1917–1996), Álvaro Carrillo (1921–1969), Armando Manzanero (1935–), Mayra Montero (1952–).
Interpreten
Alci Acosta, Alfredo Antonini, Alfredo Sadel, Antonio Machín, Gregorio Barrios, Bola de Nieve, Benny Moré, Café Quijano, Carmen Delia Dipiní, Chavela Vargas, Chucho Avellanet, Daniel Santos, Eydie Gormé, John Serry, José Feliciano, Javier Solís, Juan Arvizu, Julio Jaramillo, La Lupe, La Sonora Matancera, Leo Marini, Los Guacamayos, Los Paraguayos, Lucho Gatica, Luis Miguel, María Teresa Vera, Moncho, Nelson Ned, Nestor Mesta Chayres, Olga Guillot, Pedro Vargas, Rafael Colón, Rolando Laserie, Ruth Fernández, Tania Libertad, Terig Tucci, Tito Rodríguez, Toña la Negra, Trío Guadalajara, Trío Los Panchos, Trío Los Tres Diamantes, Trío Los Tres Ases, Trío Los Tres Reyes, Trío Siboney. Miguel Zénon (El Arte del Bolero, 2021).
Bekannte Boleros
Adoro, Algo contigo, Aléjate, Alma corazón y vida, Amar y vivir, Amor de mis amores, Amor sin esperanza, Anillo de compromiso, Apasionado, A pesar de todo, Aquella tarde, Aquellos ojos verdes, Arráncame la vida, Aunque me cueste la vida, Ay amor, Bésame mucho, Azabache, Boda negra, Bravo, Camarera de mi amor, Caminemos, Campanitas de cristal, Cancionero, Cómo fue, Como un bolero, Cómo fue, Como un bolero, Contigo aprendí, Contigo en la distancia, Copas de licor, Cuando calienta el sol, Cuando vuelva a tu lado, Cuatro palabras, La barca, La copa rota, La Paloma, Delirio, Desesperanza, Dijiste no, Distancia, Dos almas, El almanaque, El reloj, Encadenados, En el juego de la vida, En el último trago, Entrega total, Ese bolero es mío, Eso eres para mi, Espérame en el cielo, Esperaré, Ésta tarde vi llover, Fango negro, Fatalidad, Flores negras, Gema, Hoja seca, Hola soledad, Incertidumbre, Irresistible, Juramento, La flor de la canela, La gran tirana, Lamento borincano, La puerta, La revancha, La última noche, La vida es un sueño, Llanto de luna, Luz de luna, Mala sangre, María bonita, Mentiras tuyas, Miénteme, No, Noche no te vayas, No me platiques más, No me quieras tanto, No puedo ser feliz, Nuestro balance, Nuestro juramento, Nuestro secreto, Obsesión, Ódiame, Ofrenda, Pecadora, Perfidia, Perfume de gardenias, Piel canela, Piensa en mi, Poquita fe, Por eso te perdono, Presentimiento, Puro teatro, Qué te pedi, Quien tiene tu amor, Quiéreme mucho, Quizás, quizás, quizás, Rayito de luna, Rondando tu esquina, Sabor a mi, Se vive solamente una vez, Somos novios, Sabor a mi, Sabrá Dios, Si Dios me quita la vida, Sígamos pecando, Si me pudieras querer, Si tú me dices ven, Si me pudieras querer, Se as flores pudessem falar, Sin ti, Sin un amor, Solamente una vez, Sombras, Sombras (nada más), Somos, Soy lo prohibido, Te extraño, Temes, Te quedarás, Tengo un pecado nuevo, Tiemblas, Toda una vida, Total, Tres palabras, Triunfamos, Tu condena, Tu me acostumbraste, Una aventura más, Último fracaso, Una copa más, Un poco más, Usted, Veinte años, Ven a mis brazos, Vereda tropical, Vete de mi, Virgen de medianoche, Voy a apagar la luz, Yo tengo un pecado nuevo.
Queer-Ästhetik
El Bolereo
Roberto Strongman, Professor am interdisziplinären Department of Black Studies, führt in seinem Essay The Latin America Queer Aesthetics of „El Bolereo“ einen Neologismus ein: „El Bolereo“. Unter diesen neuen Fachterminus fasst er Erscheinungen im Genre des Bolero-Musikstils, die er als Queer-Ästhetik beschreibt:
Dazu gehören zum Beispiel androgyne Stimmen vieler Bolero-Interpreten. Falsett bei männlichen Sängern, wie zum Beispiel bei Lucho Gatica und Antonio Machín oder tiefe rauchige Stimmen bei weiblichen Interpreten, wie zum Beispiel bei Chavela Vargas. Strongman zitiert Iris M. Zavala:
Roberto Strongman sieht in den schwulen Liebesromanen El lugar sin límites (1966, deutsch: Ort ohne Grenzen) des Chilenen José Donoso, verfilmt 1977 von Arturo Ripstein und « El beso de la mujer araña » (1976, deutsch: Der Kuss der Spinnenfrau) des Argentiniers Manuel Puig, verfilmt 1985 von Héctor Babenco, die ersten Exemplare einer neuen Literaturgattung, des „Bolero-Romans“:
Strongman führt weiter aus:
Eine der ersten Bolero-Komponistinnen, -Guitarristinnen und -Sängerinnen, María Teresa Vera, „die Stimme der Trova“, benutzt geschickt den Bolero, um sich als Lesbe zu outen. Homosexualität war in Kuba zu dieser Zeit gesellschaftlich verpönt und stand sogar unter Strafe. María Teresa Vera singt unverblümt in der zweiten Strophe des Boleros « He perdido contigo » des kubanischen Komponisten Luis Cárdenas Triana:
Wäre es zu Problemen mit staatlichen Autoritäten gekommen, hätte sie sich aus der Affaire ziehen können, indem sie behauptete, sie habe lediglich den Originaltext des Boleros vorgetragen, wortgetreu wie ihn ihre männlichen Kollegen singen. In Kuba gilt unbestritten, dass María Teresa lesbisch veranlagt war:
Grammatisches Cross-Gendering
In der spanischen Sprache markieren Morpheme das Geschlecht des Sprechers. Je nachdem, ob eine Frau oder ein Mann denselben Bolero singt, müssten diese Morpheme geschlechtsspezifisch angepasst werden. Manche Bolerosänger und Bolerosängerinnen passen diese Morpheme bewusst nicht heterosexuell an, sondern singen aus der Perspektive des anderen Geschlechts, ein „Bolereo“-Phänomen, das Roberto Strongman „Queering Grammatical Gender“ nennt.
Als Beispiel zitiert Strongman den Bolero « El anillo de compromiso » (Der Verlobungsring). Chavela Vargas singt ihn nämlich aus männlich-lesbischer Perspektive. Die entsprechen den Verszeilen lauten, links, was Chavela Vargas als Lesbe singt, rechts daneben, was sie aus heterosexueller Perspektive als Frau hätte singen sollen:
Genre-übergreifende Wirkung
Der US-amerikanische Bolero- und Gender-Forscher Roberto Strongman vertritt die Meinung, dass das Bolero-Genre neben den musikalischen auch literarische und kinematographische Komponenten umfasst:
So verwendet der spanische Filmregisseur Pedro Almodóvar berühmte Bolero-Musiktitel als emblematische Untermalung in seinen Filmen:
- Entre tinieblas, 1983, darin: Encadenados (Lucho Gatica)
- La ley del deseo, 1987, darin: Lo dudo (Trío Los Panchos)
- Mujeres al borde de un ataque de nervios, 1988, darin: Puro teatro (La Lupe)
- Tacones lejanos, 1991, darin: Piensa en mí (Luz Casal), Bolero des Komponisten Agustín Lara
- La flor de mi secreto, 1995, darin: En el útimo trago (Chavela Vargas singt diesen bolero-ranchera und Ay amor (Bolero des Pianisten Bola de Nieve)).
Im Animationsfilm Chico & Rita der spanischen Regisseure Fernando Trueba, Javier Mariscal und Tono Errando aus dem Jahr 2010 singen die Figuren berühmte Boleros wie zum Beispiel Bésame mucho und Sabor a mí.
Welche Bedeutung diesem Genre in der hispanophonen Welt zukommt, kann man unter anderem daran ablesen, dass ein lateinamerikanischer Internet-Sender Tiempo de boleros ganzjährig rund um die Uhr ausschließlich Bolero-Musik sendet und ein einschlägiges thematisches Portal betreibt.
In ihrem Bolero-Roman La última noche que pasé contigo beschreibt Mayra Montero die sozialpsychologische Funktion dieses romantischen Genres wie folgt:
Der Bolero-Roman – la novela bolero
Dem Genre romantischer Lieder, dem Bolero, begegnet man auch in der spanischsprachigen Unterhaltungsliteratur. In Buchtiteln und im Rahmen von Erzählungen wird auf Bolero-Poesie angespielt. Romanfiguren identifizieren ihre sentimentale Situation mit Bolero-Versen, fühlen sie so stark, als seien diese lyrischen Texte für sie persönlich geschrieben worden. In der lateinamerikanischen Belletristik spricht man deshalb seit den 1980er Jahren von einer neuen literarische Untergattung, der sogenannten «novela bolero», dem Bolero-Roman. Zum Beispiel hat der chilenischen Schriftstellers Roberto Ampuero einen solchen Bolero-Roman geschrieben,Bolero in Havanna (1994), eine Kriminalgeschichte. Eine Hauptfigur, Plácido el Rosal, ist Bolero-Sänger. Der Bolero stellt in diesem Roman Intertextualität her, indem bekannte Liedverse als Kapitelüberschriften und Mottos dienen, wie « La barca » (Bolero des mexikanischen Komponisten Roberto Cantoral), « Tú me acostumbraste » (Bolero des kubanischen Liedermachers Frank Domínguez) oder « Ésta tarde vi llover » (Bolero des mexikanischen Komponisten Armando Manzanero):
Gioconda Marún beschreibt die Funktion des Boleros in dieser Literatur-Subgattung wie folgt:
Auch die mexikanischen Autorin Ángeles Mastretta hat einen Bolero-Roman geschrieben, Arráncame la vida („Reiß mir das Leben aus dem Leib!“), der nach einem berühmten Tango des mexikanischen Komponisten Agustín Lara benannt ist. In dieser feministischen Erzählungen singen die Hauptfiguren – auf Kapitel verteilt – strophenweise die Bolero-Version dieses Liedes, wie sie Toña la Negra interpretiert hat. Der spanische Literaturwissenschaftler Álavaro Salvador Jofre hat in dem Essai Novelas como boleros, boleros como novelas: una lectura de Arráncame la vida diesen feministischen Bolero-Roman interpretiert.
Der erotische Bolero-Roman der kubanisch-puerto-ricanischen Autorin Mayra Montero, La última noche que pasé contigo („Die letzte Nacht, die ich mit Dir verbracht habe“), trägt den Titel des gleichnamigen Boleros des kubanischen Komponisten Bobby Collazo. Alle acht Kapitelüberschriften sind nach Bolero-Titeln benannt: „Barbujas de amor“, „Sabor a mí“, „Negra consentida“, „Amor, qué malo eres“, „Nosotros“, „Vereda tropical“, „Somos“ und „La última noche que pasé contigo“. Während einer Kreuzfahrt durch die Karibik erweckt das Erklingen von Boleros assoziativ Erinnerungen in den Protagonisten Celia und Fernando und entfacht erneut ihr Verlangen und ihre Leidenschaft.
Eine Auflistung der bekanntesten Bolero-Romane findet man im Essay Robert Strongmans The Latin American Queer Aesthetics of « El Bolereo », S. 43/44.
Status als Kulturerbe
Im August 2021 wurde der Bolero auf Kuba zum Kulturerbe der Nation erklärt. Auf Antrag Kubas und Mexikos erfolgte 2023 die Aufnahme in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit.
Literatur
Auf Spanisch
- Jorge Eliécer Ordóñez: Llanto de luna: entre el bolero y la poesía. In: Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid 2002. Volltext
- Tony Évora: El libro del bolero. Alianza Editorial, Madrid 2001, ISBN 84-206-4521-4.
- Celina Fernández: Los Panchos: la historia de los embajadores de la canción romántica contada por su voz Rafael Basurto Lara. Ediciones Martínez Roca, Madrid 2005, ISBN 84-270-3071-1.
- Fernando Linero Montes: El bolero en sus propias palabras. Editorial Icono, Bogotá 2008, ISBN 978-958-97842-8-0. (google books)
- José Loyola Fernández: En ritmo de bolero: el bolero en la música bailable cubana. Ediciones Huracán, Río Piedras 1996, ISBN 0-929157-37-0.
- Gioconda Marún: La función del bolero en « Boleros en la Habana » de Roberto Ampuero. In: Actas XIV Congreso AIH (Vol. IV), S. 403/409; cervantes.es (PDF; 1,8 MB) auf Centro Virtual Cervantes
- Juan Montero Aroca: Bolero. Historia de un siglo de emociones. 2. Ausgabe. Tirant Humanidades, Valencia 2013, ISBN 978-84-15442-95-0.
- Mariano Muñoz-Hidalgo: Bolero y modernismo: la canción como literatura popular. In: Literatura y Lingüística N°18 ISSN 0716-5811 S. 101–120, doi:10.4067/S0716-58112007000100005.
- Yolanda Novo Villaverde, María do Cebreiro Rábade Villar: Te seguirá mi canción del alma. El bolero cubano en la voz de las mujeres. Universidad de Santiago de Compostela, 2008, ISBN 978-84-9750-915-2. (Auszüge auf: google books)
- Manuel Román Fernández: Bolero de amor. Historias de la canción romántica. editorial Milenio, Lleida 2015, ISBN 978-84-9743-665-6.
- Jorge Rosario-Vélez: Somos un sueño imposible: ¿Clandestinidad sexual del bolero en « la última noche que pasé contigo » de Mayra Montero? In: Revista Iberoamericana. Vol. LXVIII, Núm. 198, Enero-Marzo 2002, S. 67–77. doi:10.5195/reviberoamer.2002.5746 (PDF-Datei, auf der Website des Zeitschrift Revista Iberoamericana) (Eine Monographie zum Bolero La última noche que pasé contigo: „Die letzte Nacht, die ich mit Dir zusammen verbracht habe“).
- Francisco Torres: La novela bolero latinoamericana, El Centauro, Mexiko D.F. 2008, ISBN 978-970-35-0076-5. (google book)
- Álvaro Salvador Jofre: Novelas como boleros, boleros como novelas: una lectura de Arráncame la vida. In: Anales de Literatura Hispanoamericana, 1999,28, S. 1171–1190; revistas.ucm.es (PDF; 2,5 MB).
- Iris M. Zavala: El bolero. Historia de un amor. Celeste Ediciones, Madrid 2000, ISBN 84-8211-262-7.
- Iris M. Zavala: El bolero: el canto del deseo. In: Anthropos, revista de documentación científica de la cultura. n°166/167, Barcelona Mayo-agosto 1995, S. 105–113. (google books)
Auf Deutsch
- Roberto Ampuero: Bolero in Havanna. Das Neue Berlin, 1997, ISBN 978-3-360-01206-7.
- Spanische Originalausgabe: Boleros en La Habana, Debolsillo 2013, ISBN 978-956-325-093-0.
- José Donoso: Ort ohne Grenzen. Suhrkamp 1979, ISBN 978-3-518-37015-5.
- Spanische Originalausgabe: El lugar sin límites. Catedra 2004, ISBN 978-84-376-1776-3.
- René Girard: Figuren des Begehrens. Das Selbst und der Andere in der fiktionalen Realität. 2. Auflage. LIT, Münster 2012, ISBN 978-3-643-50378-7.
- Französische Originalausgabe: Mensonge romantique et vérité romanesque. Fayard/Pluriel, Paris 1961, ISBN 2-01-278977-3. „Romantische Lüge und romanhafte Wahrheit“)
- Ángeles Mastretta: Mexikanischer Tango. Suhrkamp Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1988, ISBN 978-3-518-38287-5; Ariane Bartin: Rezension. In: Der Spiegel. Nr. 33, 1988 (online).
- Spanische Originalausgabe: Arráncame la vida. Booket, 2017, ISBN 84-322-3288-2. (Die wörtliche Übersetzung des Buchtitels wäre: Reiß’ mir das Leben aus dem Leib!.)
- Mayra Montero: Bolero der Leidenschaft. Galgenberg, Hamburg 1992, ISBN 978-3-87058-123-7. – (Rezension).
- Spanische Originalausgabe: La última noche que pasé contigo. Tusquets Editores, Barcelona 2014, ISBN 978-84-8383-835-8 –(assets.espapdf.com (PDF) – Auszüge.
- Manuel Puig: Der Kuss der Spinnenfrau. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1979, ISBN 978-3-518-37369-9.
- Spanische Originalausgabe: El beso de la mujer araña. Seix Barral 2003, ISBN 978-84-322-1727-2.
- Manfred Schneider: Liebe und Betrug. Die Sprachen des Verlangens. Carl Hanser Verlag, München/Wien 1992, ISBN 3-446-16575-4. (Rezension von Reinhart Baumgart: Das Zwitschern des Fleisches. In: Die Zeit, Nr. 37/1992).
Auf Englisch
- Moshe Morad: Queer Bolero: Bolero Music as an Emotional and Psychological Space for Gay Men in Cuba. In: Psychology Research. Vol. 5, No. 10, Oktober 2015, S. 565–584. (PDF; 246 kB)
- Moshe Morad: Fiesta de diez pesos: Music and Gay Identity in Special Period Cuba. ISBN 978-1-4724-2457-0. (google.books)
- Vanessa Knights: Tears and Screams: Performances of Pleasure and Pain in the Bolero. Vortrag anlässlich der 12th Biennial Conference of the International Association for the Study of Popular Music. Stream: Queering Practice. Session: Transgressing Gender Boundaries. 3. Juli 2003 McGill University, Montréal, Canada. ncl.ac.uk (PDF)
- Susan Sontag: Notes on „Camp“. 1964. In: Against Interpretation: And Other Essays. Penguin, London 2009, ISBN 978-0-312-28086-4; Monoskop.org (PDF; 132 kB)
- Roberto Strongman: The Latin America Queer Aesthetics of El Bolereo. In: Canadian Journal of Latin America and Caribbean Studies / Revue canadienne des études latino-américaines et caraïbes. Vol. 32, No. 64, 2007, S. 39–78. (Abstract bei JSTOR und Volltext in The Free Library)
Weblinks
Rhythmus und Perkussions-Instrumente
- Rhythmus des Boleros Video auf YouTube – Perkussions-Demonstration des kubanischen Bolero-Rhythmus durch den Schlagzeug-Lehrers Michael de Miranda.
- Rhythmus des Cha-Cha-Cha Video auf YouTube – Perkussions-Demonstration des Cha-Cha-Cha-Rhythmus. Instrumente: Güiro, Congas, Timbales und Cha-Cha-Cha-Bell.
- Bolero-Rhythmus mit Maracas Video auf YouTube.
Bekannte Interpreten und Boleros
- Veinte años. Video auf YouTube – María Teresa Vera und Rafael Zequeira, das legendäre Duo de la Trova Cubana, um 1935.
- Alma, corazón y vida. Video auf YouTube – Trío Los Panchos.
- Lágrimas negras. Video auf YouTube – kubanische Straßenmusikanten interpretieren spontan einen populären «Bolero-son» des Trío Matamoros aus dem Jahre 1929.
Musikportal «Tiempo des boleros»
- Tiempo de boleros - 24 Stunden Bolero-Musik. – Musik-Portal des lateinamerikanischen Internetsenders «Tiempo de boleros».
- Videos zur Geschichte des Boleros
Einzelnachweise